Chemie
- Details
- Zugriffe: 20095
Name: Johanna Semler, 2021-06
Enantiomere
- Moleküle, die zueinander spiegelbildlich sind, nennt man Enantiomere.
- Enantiomere sind zwar Isomere, unterscheiden sich aber nicht in ihrer Summenformel oder Struktur.
- Ihr einziger Unterschied wird im Aufbau (Konfiguration) bemerkbar. Sie besitzen nämlich chirale Kohlenstoffe.
- Zwei Enantiomere sind nie deckungsgleich. Deshalb gibt es einmal die D-Form und die L-Form rechtsdrehend und linksdrehend.
- Natürliches Vorkommen:bei Zucker/Kohlenhydraten meist D-Form, bei den natürlichen (canonischen) Aminosäuren immer die L-Form!
- Enantiomere sind optisch aktiv.
Drehung im Uhrzeigersinn: (+)- Form; Drehung gegen den Uhrzeigersinn: (-)- Form
- Unterschiedliche Enantiomere besitzen die gleichen physikalischen Eigenschaften.
- Enantiomere besitzen an den chiralen Kohlenstoffen eine entgegengesetze Konfiguration.
- Bsp: L- und D-Glucose sind Enantiomere, d.h. sie sind gleichzeitig auch chiral.
Besipiel: Fructose
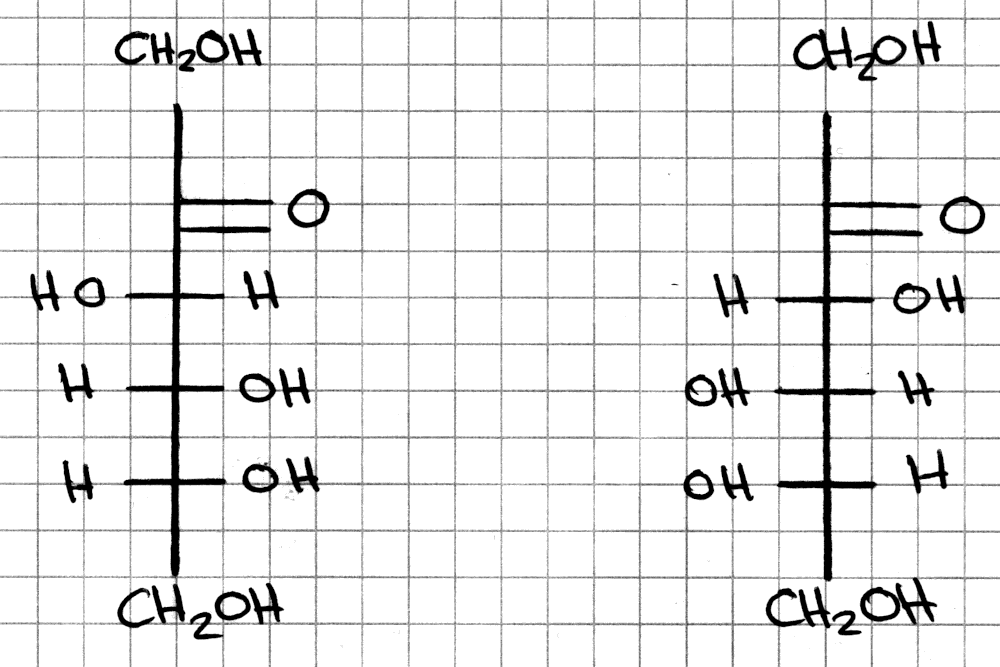
D-Fructose und L-Fructose
Beide Moleküle sind Enantiomere (Spiegelbilder, also nicht deckungsgleich!)
Chiralität (Händigkeit)
- Ein chirales Kohlenstoffatom besitzt vier unterschiedliche Substituenten.
- Bild und Spiegelbild = zwei verschiedene Formen eines Moleküls (D-, L-Form)
- Asymmetrie des Moleküls
- Chirale Verbindungen werden durch polarisiertes Licht sichtbar.
- Gemisch aus linkdrehenden und rechtsdrehenden Substanzen = Racemat
Beispiel: Weinsäure
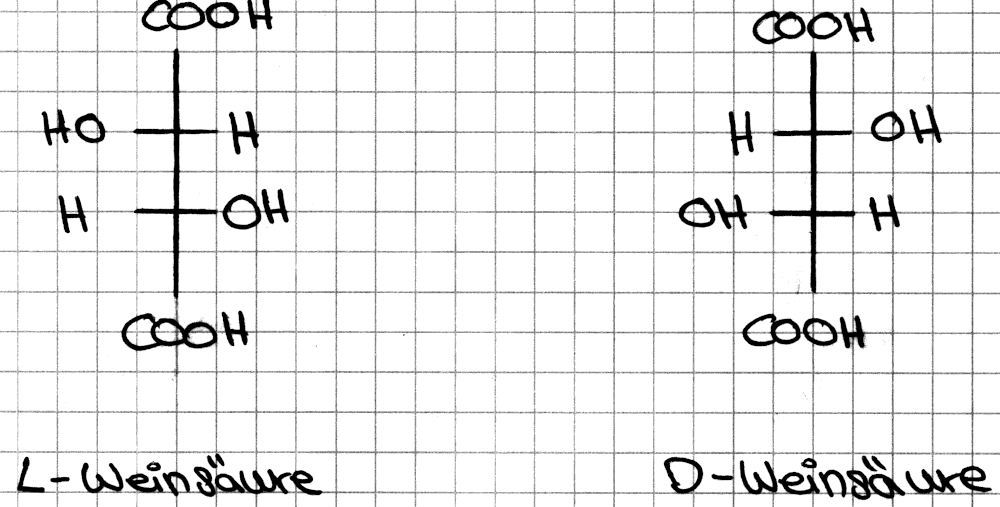
D- und L- Weinsäure
Bei beiden Molekülen liegen jeweils zwei chirale Kohlenstoffatome mit vier unterschiedlichen Substituenten vor.
Die OH-Gruppe am unteren chiralen C-Atom entscheidet über die D- bzw. L-Form.
Merke:
- Chirale Moleküle weisen zwei enantiomere Formen auf.
- Voraussetzung: Chirale Kohlenstoffe, also ein Kohlenstoffatom mit 4 unterschiedlichen Substituenten.
- Stereoisomere haben die gleiche Summen- und Strukturformel, aber nicht die gleiche räumliche Anordnung der Substituenten.
D- Form: rechtsdrehend -> OH oder funktionelle Gruppe des untersten chiralen C-Atoms auf der rechten Seite
L-Form: linksdrehend -> OH oder funktionelle Gruppe des untersten chiralen C-Atoms auf der linken Seite
Übung
Aufgabe: Prüfe, welche Kohlenstoffatome chiral sind und kennzeichne diese mit einem Sternchen. Entscheide jeweils, ob die D- oder L-Form vorliegt und verbinde zusammengehörige Enantiomere.

Übung zur Spiegelbildisomerie
-------
Lösung:
D - Glucose & L-Glucose
D - Mannose & L-Mannose
D-Galactose & L-Galactose
Jeweils bei den 4 unteren C-Atomen liegen chirale C-Atome vor.
- Organische Chemie: Stärke (Amylose und Amylopektin)
- Organische Chemie: Struktur- und Eigenschaftsbeziehungen bei organischen Kohlenwasserstoffen
- Organische Chemie: Tenside
- Organische Chemie: Titration von Glycin
- Organische Chemie: Typen von Carbonsäuren
- Organische Chemie: Verbrennung von Alkanen und CO2-Emission
- Organische Chemie: Vergleich von Siedepunkten bei Alkanen, Alkanolen, Aldehyden und Carbonsäuren
- Organische Chemie: Verseifung
- Organische Chemie: Viskosität
- Organische Chemie: Was ist Organische Chemie?
- Organische Chemie: Zusammensetzung von Waschmitteln
- Organische Chemie: Zusammensetzung von Waschmitteln und deren Funktion
- Organische Chemie: Zwischenmolekulare Kräfte und Anziehungskräfte zwischen Molekülen
- Physikalische Chemie: Die Grundlagen der Thermodynamik
