Chemie
- Details
- Zugriffe: 13424
Namen: Lea Burhenne, Leonie Horst und 2013
Sarah Aschenbrücker, Daniel Garret 2014,
Salomee Blum und Nela Zupanic 2019-11
Geschichte von der Entdeckung und Verwendung von Aluminium:
- 1825 erstmals von Hans Christian Orsted hergestellt
=> Reaktion von Aluminiumchlorid mit Kaliumamalgam als Reduktionsmittel
- 1827: reineres Aluminium durch Verwendung von metallischem Kalium (Friedrich Wöhler)
=> Aluminium war teurer als Gold
- 1859: Veröffentlichung einer verfeinerten Herstellungsweise durch Henri Étienne Sainte-Claire Deville
=> größerer Gewinn -> Aluminiumpreis fiel um 90%
- 1886: Schmelzflusselektrolyseverfahren durch Hall und Héroult
- 1889: Carl Joseph Bayer -> Bayer-Verfahren
Namensgebung:
- vom lateinischen Wort "alumen" für Alaun
- zwei Namen in Gebrauch: Aluminium und Aluminum
Eigenschaften von Aluminium:
- Aggregatszustand (RT)=fest
- relativ weiches und zähes Leichtmetall
- chemisches Element mit Elementsymbol Al und Ordnungszahl 13
- dritte Hauptgruppe, 13. IUPAC-Gruppe (Borgruppe)
- stumpfes silbrig-weiches Leichtmetall
- das silbergraues Aussehen entsteht durch die stumpfe Oxidschicht, welche sich sich schnell an der Luft bildet
- sehr unedel, trotzdem oberflächliche Reaktion wegen Passivierung mit Luft und Wasser
Physikalische Eigenschaften von Aluminium:
- Atommasse: 26,9815u
- Aggregatzustand: fest
- Dichte (gering): 2,7 g/cm3 => Aluminium ist ein Leichtmetall
- Magnetismus: paramagnetisch
- Schmelzpunkt: 660,32°C, Siedepunkt: 2470°C
- relativ weiches Metall => sehr gut verformbar und dehnbar
- Elektronegativität von 1,61
- Molekülmasse von 27 u
Chemische Eigenschaften von Aluminium:
- reines Leichtmetall bildet an Luft/mit Sauerstoff sehr schnell dünne Oxidschicht => stumpfes, silbergraues Aussehen
- sehr guter Korrosionsschutz => kann nicht rosten
- einzigartige Eigenschaften => vielseitig einsetzbares Material
- 100 % recyclingfähig ohne Qualitätseinbußen
- Formschönheit, mechanische Eigenschaften, Langlebigkeit und Wertigkeit des Werkstoffes
- nicht giftig, nicht brennbar
Vorkommen von Aluminium:
- dritthäufigstes Element der Erdkruste nach Sauerstoff und Silicium (-> 7,57 Gewichtsprozent)
- häufigstes Metall weltweit!
- fast ausschließlich in gebundener Form (meist als „Bauxit“, dem unreinen Aluminium-Erz) aufgrund seines unedlen Charakter
- größte Menge: chem. gebunden in Form von Alumosilikaten
Verwendung von Aluminium:
Verwendung als Konstruktionswerkstoff:
- Bauen von Transportmitteln (vor allem in Luft- und Raumfahrt)
- Heizelementen (z.B.: Bügeleisen und Kaffeemaschinen)
- früher auch in Fassaden und Dachelementen
=> nur interessant, wenn Gewicht eine höhere Relevanz hat als Kosten
Verwendung als Legierung:
- Herstellung von Motoren und Getriebegehäuse
(=> Aluminiumgusslegierung)
Verwendung in der Elektrotechnik:
- Überlandleitungen
- aufgrund schlechter Kontaktierung schlecht für die Stromverbindung
=> Kupfer besser geeignet
Verwendung in der Elektronik:
- Antennen und Hohlleiter
- Elektrodenmaterial
=> gute elektrische Leitfähigkeit
Verwendung für Verpackung und Behälter:
- Konservendosen, Alufolie
- Kochtöpfe und andere Küchengeräte
In jedem Haushalt zu finden: Alufolie (sehr fein gewalztes Aluminium)
Verwendung in der Optik und Lichttechnik:
- Spiegelbeschichtung in Scannern, Kraftfahrzeug-Scheinwerfern, Spiegelreflexkameras
weitere Anwendungen und Verwendung von Aluminium:
- Treibstoff einer Rakete
- Feuerwerksraketen
- Aluminieren von Stoffen -> Sie werden formbarer, weniger spröde und zunderbeständig
Produktion von Aluminium
- Primäraluminium =>Herstellung aus Mineralien
- Sekundäraluminium =>Herstellung durch Recycling
- Hauptproduktionsländer: Australien, China, Guinea, Indien, Jamaika
Gewinnung von Aluminium in drei Schritten:
1. Aufbereitung des Bauxits
- für Wirtschaftszwecke lediglich Gewinnung aus Bauxit: Bestandteile: - ca. 60% Aluminiumhydroxid
- ca. 30% Eisenoxid
- Siliciumverbindungen, Verunreinigungen
- Trennung des Bauxits von Begleitstoffen
2. Bayer-Verfahren zur Herstellung von reinem Aluminium:
-> Aufschluss mit Natronlauge: mit Natronlauge bei Erhitzung auf - 150 – 200 °C unter Druck setzen
-> Aluminiumhydroxid liegt jetzt als Aluminat-Ion in Lösung vor
- Eisenoxid wird abgefiltert
- Verdünnung und Abkühlung der Aluminat-Lösung
- es entsteht erneut nicht lösliches Aluminiumhydroxid
- Trennung aus der Natronlauge (diese wird wiederverwendet)
- Erhitzen des Aluminiumhydroxids auf 1200 °C
- es liegt nur noch sehr reines Aluminiumoxid vor (Rohstoff, der zur eigentlichen Gewinnung von Aluminium dient)
-> Schmelzflusselektrolyse zur Umformung in reines Aluminium
3. Schmelzflusselektrolyse (Hault-Heroult-Verfahren)
- Elektrolyseverfahren, wobei eine Elektrolyse von heißem geschmolzenem Salz durchgeführt wird
- Elektrolyse findet in gemauertem Elektrolyseofen statt
-> ist in mehrere Wannen eingesenkt, die innen mit Graphit beschichtet sind (mehrere Quadratmeter groß)
-> diese sind mit Aluminiumoxid gefüllt, welches mit der 10- bis 20-fachen Konzentration Kryolith angereichert ist
-> Kryolith dient zur Herabsetzung der Schmelztemperatur auf 950°C
(die Schmelzelektrolyse wäre sonst zu teuer -> Krytolith wird hinzugegeben => dadurch sinkt der Schmelzpunkt auf ca. 950°C)
- Elektrolyse wird bei einer Spannung von 4 bis 5 V und einer Stromstärke von 250.000 A durchgeführt
- von oben werden Kohleelektroden in die Schmelze eingeführt
-> dienen als Anoden
-> Oxid-Ionen werden an ihnen zu Sauerstoff oxidiert, welcher unter hoher Temperatur direkt mit den Elektroden reagiert -> Kohlenstoffmonooxid und Kohlenstoffdioxid
- Absaugen dieser Gase
-> verlassen die Aluminiumhütte über einen Schornstein
- Kohleelektroden nutzen sich mit der Zeit ab -> werden deshalb durchgängig von oben nachgeführt
-> werden bei völliger Abnutzung erneuert
- Ofen ist an der Unterseite mit Graphit ausgekleidet -> Kathode
-> Reduzierung der Aluminium-Ionen zu Aluminiumatomen
-> gewonnenes Aluminium sammelt sich am Boden der Schmelzflusselektrolysezelle, die Elektrolyt-Schmelze bleibt darüber
-Fremdstoffe lösen sich in Warmhalteöfen =>Aluminium mit einer Reinheit von ca. 99,5 – 99,9%
-> es wird mehrmals am Tag abgestochen
- die Schmelzflusselektrolyse hat sehr hohen Energiebedarf
-> ca. 14 kWh pro 1kg produziertem Aluminium
-> die elektrische Energie bestimmt den Preis des Aluminiums
-> Recycling von Aluminium gewinnt an Bedeutung, weil die Energiepreise steigen
-> momentan liefert das Recycling 20% der Weltproduktion von Aluminium
-> Recycling spart gegenüber der Gewinnung aus Bauxit bis zu etwa 95% der Energie ein
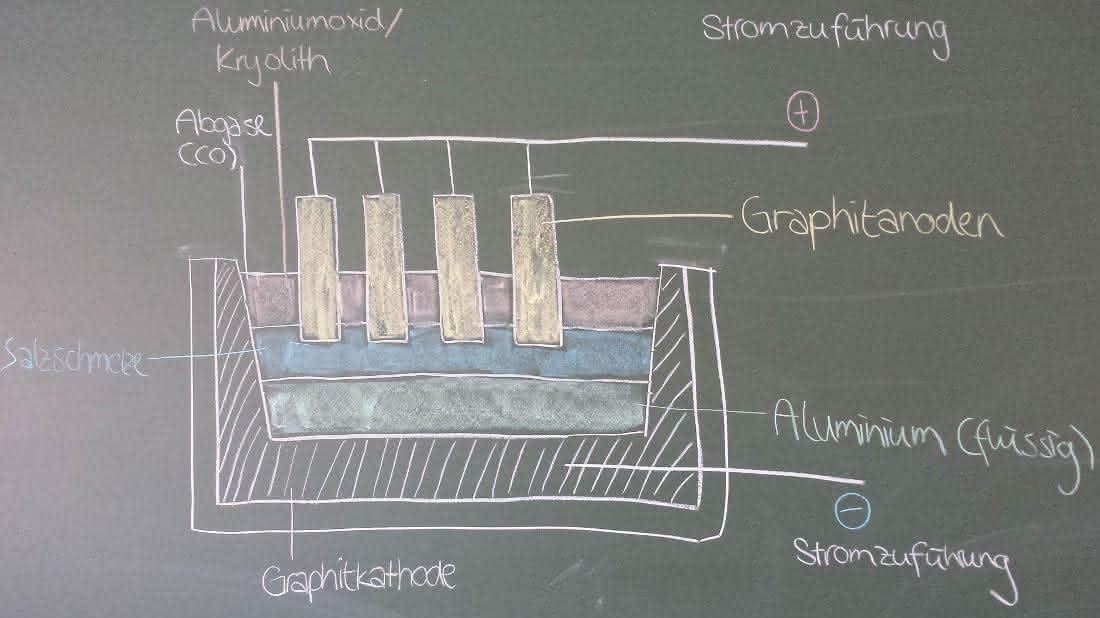
Zusammenfassung Schmelzelektrolyse
-Bauxit mit heißer Natronlauge unter Druck erhitzt: -Al2O3H2O+2H2O+NaOH ---> NaAl(OH)4
-Rotschlamm wird abfiltriert
-zurückbleibende Lösung wird verdünnt, damit Aluminiumhydroxid ausfällt
Verwendung von Aluminium:
-Preis: ~ 1500-2000€ / t
-Findet wegen der geringen Dichte oft in Luft- und Raumfahrt verwendung
-hauptsächlich Verkehr (Autoteile, ...)
-in der Elektronik weil:
-> guter Leiter
-> billiger als Kupfer
-> leicht zu verarbeiten
-> sehr leichtes Metall
Neues Verfahren zur Aluminiumgewinnung
=> das Elysis Verfahren (2015) soll ohne Graphitelektroden auskommen, so die Emissionen an CO2 senken. Nicht berücksichtigt wird dabei allerdings der nach wie vor hohe Bedarf an elektrischen Strom.
- neue und umweltfreundlichere Produktionsmöglichkeit von Aluminium
- bei der Produktion=> Freisetzung von Sauerstoff statt Treibhausgasen wie bei der Schmelzflusselektrolyse
- Apple als Kooperationspartner, da Apple großen Bedarf an Aluminium bei der Produktion von Geräten hat
- soll bis 2024 marktreif sein.
- Anorganische Chemie: Metalle - Eisen und Eisenverbindungen
- Anorganische Chemie: Metalle - Erdalkalimetalle
- Anorganische Chemie: Metalle - Gold
- Anorganische Chemie: Metalle - Korrosion und Korrosionsschutz
- Anorganische Chemie: Metalle - Kupfer und Kupferverbindungen
- Anorganische Chemie: Metalle - Uran
- Anorganische Chemie: Metalle und die Metallbindung
- Anorganische Chemie: Oxidationsstufen des Mangans
- Anorganische Chemie: Periodensystem (!)
- Anorganische Chemie: pH-Abhängigkeit von Redoxpotentialen (über die Nernst-Gleichung)
- Anorganische Chemie: pH-Elektrode & elektrochemische pH-Wert-Bestimmung
- Anorganische Chemie: pH-Wert (und pOH-Wert)
- Anorganische Chemie: Phosphor
- Anorganische Chemie: Photovoltaik und Brennstoffzelle
- Anorganische Chemie: Protolyse von Phosphorsäure
- Anorganische Chemie: Protolysereaktionen bei Salzen (Säure-Base Reaktionen)
- Anorganische Chemie: Reaktion von Säuren und Basen mit Wasser
- Anorganische Chemie: Reaktionsgeschwindigkeit und Messung der Reaktionsgeschwindigkeit
- Anorganische Chemie: Reaktionsgeschwindigkeit, Momentangeschwindigkeit und Messung (sowie HWZ)
- Anorganische Chemie: Reaktionsgeschwindigkeitsmessung von Thiosulfationen mit Säure
- Anorganische Chemie: Redoxreaktionen aufstellen
- Anorganische Chemie: Redoxreaktionen im Alltag
- Anorganische Chemie: Salpetersäure HNO₃ - Herstellung, Verwendung, Eigenschaften
- Anorganische Chemie: Salpetrige Säure
- Anorganische Chemie: Salze
- Anorganische Chemie: Salzherstellung durch Neutralisation
- Anorganische Chemie: Sauerstoff
- Anorganische Chemie: Sauerstoffsäuren des Chlors
- Anorganische Chemie: Sauerstoffsäuren des Phosphors
- Anorganische Chemie: Säure-Base Chemie (Brönsted-Definitionen)
- Anorganische Chemie: Säure-Base-Puffer und Puffersysteme
- Anorganische Chemie: Säurestärke (pKs) und Basenstärke (pKb)
- Anorganische Chemie: Schwefel
- Anorganische Chemie: Schwefelsäure
- Anorganische Chemie: Stickstoff
- Anorganische Chemie: Struktur von Salzen, Ionengitter und Ionenbildung
- Anorganische Chemie: Übungsaugaben zum Massenwirkungsgesetz (MWG)
- Anorganische Chemie: Vergleich von Ionenbindung und Atombindung
- Anorganische Chemie: Wasserstoff
- Anorganische Chemie: Wie berechnet man Neutralistionsaufgaben (Beispielaufgaben)
- Anorganische Chemie: Wie funktioniert der Lithium-Ionen-Akku?
- Anorganische Chemie: Zink
- Anorgansiche Chemie: Redoxreaktion - Beispielaufgaben
- Biochemie: Biokatalysatoren (Enzyme)
- Chemie: Oxidationszahlen und deren Bestimmung (!)
- Farbigkeit und Molekülstruktur
- Glossar: Fachbegriffe der anorganischen und organischen Chemie mit Erklärungen
- Komplexchemie: Anwendungen der Komplexchemie
- Komplexchemie: Aquakomplexe
- Komplexchemie: Aufbau von Komplexen
- Komplexchemie: Chelatkomplexe
- Komplexchemie: Historischer Abriss der Entdeckung der Komplexchemie
- Komplexchemie: In der Natur vorkommende (biologische) Komplexverbindungen
- Komplexchemie: Komplexe Gleichgewichtsreaktionen und die Stabilitätskonstanten
- Komplexchemie: Komplexstabilitätskonstante und Komplexzerfallskonstante
- Komplexchemie: Ligandenaustauschreaktionen
- Komplexchemie: Nomenklatur (Benennung) von Komplexen
- Komplexchemie: Wasserenthärtung
- Ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit in Chemie
- Organische Chemie: Gelatine
- Selektivität und Spezifität von Katalysatoren
- Herstellung von Maßlösungen
- I-Effekte beeinflussen die Säurestarke von Carbonsäuren
- Organische Chemie: Oxidative Fettumwandlung (Ranzigwerden von Fetten)
- Organische Chemie: Alkane - feste Alkane // Wachse und Paraffine
- Organische Chemie: Alkane - flüssige Alkane
- Organische Chemie: Alkane - gasförmige Alkane
- Organische Chemie: Alkanole (Alkohole)
- Organische Chemie: Alkene und Alkine
- Organische Chemie: Alkohol und seine Wirkung auf Menschen
- Organische Chemie: Alkoholate
- Organische Chemie: Alkohole: Ethanolherstellung durch alkoholische Gärung und großtechnische Produktion
- Organische Chemie: Aminosäuren - Peptidbindung, Typen, Aufbau, Reaktionen
- Organische Chemie: Anorganische Ester
- Organische Chemie: Aufgaben und Übungen zur Nomenklatur bei organischen Verbindungen
- Organische Chemie: Benzin und Diesel
- Organische Chemie: Bestimmung von Schmelz- und Siedepunkten
- Organische Chemie: Biogasanlagen
- Organische Chemie: Brennbarkeit von Kohlenwasserstoffen
- Organische Chemie: Carbonsäuren: homologe Reihe, Verwendung
- Organische Chemie: Carbonylverbindungen - Aldehyde
- Organische Chemie: Carbonylverbindungen - Ketone
- Organische Chemie: chemische Nachweise bei organischen Verbindungen
- Organische Chemie: Cis-/ trans-Isomerie und E/Z-Isomerie
- Organische Chemie: Cycloalkane und Cykloalkene
- Organische Chemie: Darstellungsweisen organischer Verbindungen
- Organische Chemie: Der Einfluss der I-Effekte auf die Säurestärke
- Organische Chemie: Die Aminosäure Glycin
- Organische Chemie: Die Chemie der "Shisha"
- Organische Chemie: Die Harnstoffsynthese von Friedrich Wöhler
- Organische Chemie: Eigenschaften von Aminosäuren
- Organische Chemie: Einfluss von Molekülmasse und Van der Waals-Kräften auf die Schmelz- und Siedepunkte
- Organische Chemie: Elektrophile und nukleophile Addition
- Organische Chemie: Eliminierung
- Organische Chemie: Energetische Betrachtung organischer Reaktionen
- Organische Chemie: Erdöl und Erdgas
- Organische Chemie: Erdöldestillation zur Gewinnung von Kohlenwasserstoffen
- Organische Chemie: Ester und die Veresterung
- Organische Chemie: Esterspaltung durch Hydrolyse
- Organische Chemie: Ethan
- Organische Chemie: Ethanol
- Organische Chemie: Ethen, Propen und Buten
- Organische Chemie: Ethin
- Organische Chemie: Ethin, Propin, Butin
- Organische Chemie: Färbeverfahren
- Organische Chemie: Fehlingprobe & Tollens-Probe
- Organische Chemie: Fehlingprobe und reduzierende Eigenschaften bei Kohlenhydraten
- Organische Chemie: Fette
- Organische Chemie: Fetthärtung und Margarineherstellung
- Organische Chemie: Fettsäuren
- Organische Chemie: Fischer-Projektion und die Umwandlung in die Haworth-Projektion
- Organische Chemie: Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe (FCKW)
- Organische Chemie: Fruchtsäuren
- Organische Chemie: Fructose
- Organische Chemie: Galactose (!)
- Organische Chemie: Glucose (Traubenzucker)
- Organische Chemie: Glycogen (tierische Stärke)
- Organische Chemie: Glycosidische Bindung
- Organische Chemie: Gummi und Kautschuk
- Organische Chemie: Halogenalkane (!)
- Organische Chemie: Homologe Reihe der Alkane (!)
- Organische Chemie: I-Effekte
- Organische Chemie: Insulin
- Organische Chemie: Isobuten
- Organische Chemie: Isomaltose & Maltose als typische Disaccharide
- Organische Chemie: Isomerieformen
- Organische Chemie: Kerosin und Schweröl als Erdölbestandteile
- Organische Chemie: Keto-En(di)ol-Tautomerie bei Monosacchariden
- Organische Chemie: Kohle und Graphit
- Organische Chemie: Kohlenhydrate - Disaccharide
- Organische Chemie: Kunststoffe I - Allgemeines und radikalische Polymerisation
- Organische Chemie: Kunststoffe im Vergleich: Thermoplaste
- Organische Chemie: Lactose
- organische Chemie: Löslichkeit von organischen Verbindungen (polare und apolare Lösungsmittel)
- Organische Chemie: Mechanismus Veresterung
- Organische Chemie: mehrwertige Alkohole (Alkanole)
- Organische Chemie: Methan
- Organische Chemie: Nachweis von Proteinen (Ninhydrin-Reaktion)
- Organische Chemie: Nachweise für ungesättige Fettsäuren
- Organische Chemie: Nitril als wichtiger Kunststoff
- Organische Chemie: Nomenklatur und Benennung von organischen Kohlenwasserstoffen
- Organische Chemie: Nukleophile Addition
- Organische Chemie: Nukleophile Substitution
- Organische Chemie: Optische Aktivität
- Organische Chemie: Oxidation und Reduktion von Aldehyden
- Organische Chemie: Oxidation von Alkoholen
- Organische Chemie: Oxidation von Glucose mit Methylenblau (blaues Wunder)
- Organische Chemie: Pektine
- Organische Chemie: Petrochemie
- Organische Chemie: Plexiglas als Kunststoff
- Organische Chemie: Polare und apolare Lösungsmittel und Lösungmitteleigenschaften (!)
- Organische Chemie: Polykondensation von Nylon
- Organische Chemie: Polysaccharide
- Organische Chemie: Propan
- Organische Chemie: Radikalische Substitution
- Organische Chemie: Reaktionsmechanismen der organischen Chemie (Übersicht)
- Organische Chemie: Redoxreaktionen und Oxidationszahlen bei organischen Verbindungen
- Organische Chemie: Saccharose
- Organische Chemie: Schmelz- und Siedebereiche von Fetten und Ölen
- Organische Chemie: Schmelz- und Siedepunkte von Alkanen und Alkenen
- Organische Chemie: Schmerzmittel
- Organische Chemie: Spiegelbildisomerie (Stereoisomerie)
- Organische Chemie: Stärke (Amylose und Amylopektin)
- Organische Chemie: Struktur- und Eigenschaftsbeziehungen bei organischen Kohlenwasserstoffen
- Organische Chemie: Tenside
- Organische Chemie: Titration von Glycin
- Organische Chemie: Typen von Carbonsäuren
- Organische Chemie: Verbrennung von Alkanen und CO2-Emission
- Organische Chemie: Vergleich von Siedepunkten bei Alkanen, Alkanolen, Aldehyden und Carbonsäuren
- Organische Chemie: Verseifung
- Organische Chemie: Viskosität
- Organische Chemie: Was ist Organische Chemie?
- Organische Chemie: Zusammensetzung von Waschmitteln
- Organische Chemie: Zusammensetzung von Waschmitteln und deren Funktion
- Organische Chemie: Zwischenmolekulare Kräfte und Anziehungskräfte zwischen Molekülen
- Physikalische Chemie: Die Grundlagen der Thermodynamik
